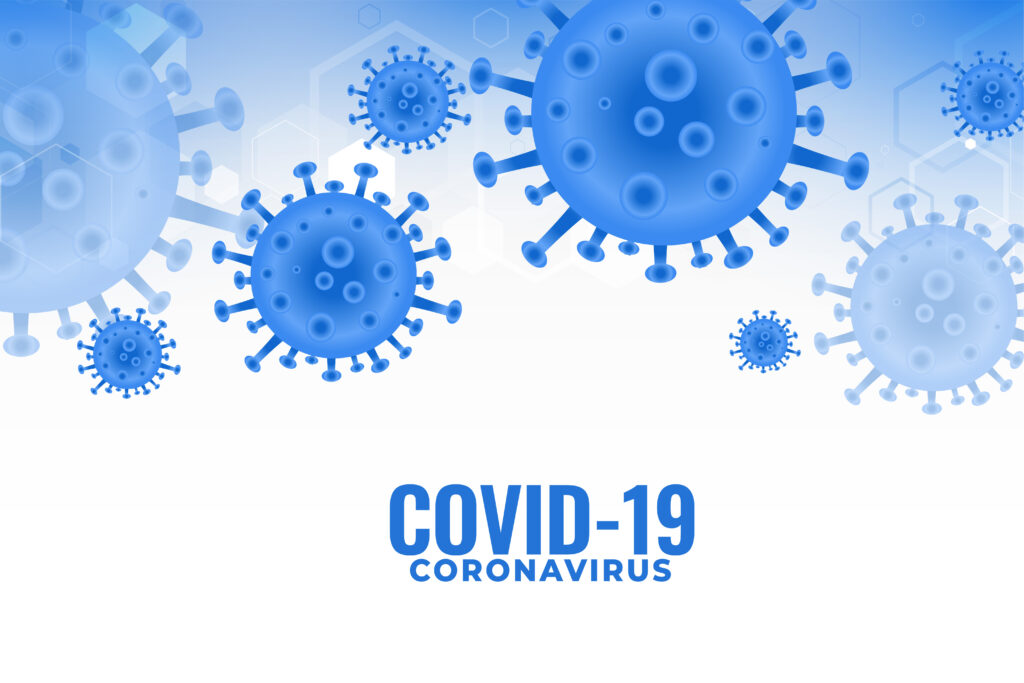Biologische Gefahrstoffe: Unsichtbare Risiken am Arbeitsplatz und effektive Schutzmaßnahmen

In vielen Arbeitsbereichen sind Beschäftigte täglich biologischen Gefahrstoffen ausgesetzt, die potenziell gesundheitsschädlich sein können. Diese Mikroorganismen, zu denen Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten zählen, können Infektionen, allergische Reaktionen oder toxische Effekte hervorrufen. Ein aktuelles Beispiel für einen solchen biologischen Gefahrstoff ist das Coronavirus. Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen Arten biologischer Gefahrstoffe, erläutert das Coronavirus als spezifischen Gefahrstoff und gibt einen Überblick über notwendige Schutzmaßnahmen.
Definition und Klassifizierung biologischer Gefahrstoffe
Biologische Gefahrstoffe, auch als Biostoffe bezeichnet, sind Mikroorganismen, die beim Menschen Krankheiten verursachen können. Gemäß der BAuA werden sie basierend auf ihrem Infektionsrisiko in vier Risikogruppen eingeteilt:
- Risikogruppe 1: Biostoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit hervorrufen.
- Risikogruppe 2: Biostoffe, die Krankheiten beim Menschen verursachen können und eine Gefahr für Beschäftigte darstellen könnten; eine Verbreitung in der Bevölkerung ist jedoch unwahrscheinlich; wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich.
- Risikogruppe 3: Biostoffe, die schwere Krankheiten beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen können; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen; wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich.
- Risikogruppe 4: Biostoffe, die schwere Krankheiten beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Beschäftigte darstellen; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist groß; wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist nicht möglich.
Diese Klassifizierung dient als Grundlage für die Festlegung von Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz.
Unterstützung für weitere Schutzmaßnahmen finden Sie auf www.arbeitsschutz-bonn.de.
Das Coronavirus als biologischer Gefahrstoff
Das Coronavirus, insbesondere SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht, gehört zur Risikogruppe 3. Es kann schwere Atemwegserkrankungen hervorrufen und stellt eine ernsthafte Gefahr für Beschäftigte dar, insbesondere im Gesundheitswesen, in Laboratorien und in Berufen mit häufigem Personenkontakt. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion, aber auch durch den Kontakt mit kontaminierten Oberflächen.
Schutzmaßnahmen gegen biologische Gefahrstoffe
Um das Risiko einer Infektion mit biologischen Gefahrstoffen wie dem Coronavirus zu minimieren, sind folgende Schutzmaßnahmen essenziell:
- Gefährdungsbeurteilung: Arbeitgeber müssen potenzielle biologische Gefährdungen am Arbeitsplatz identifizieren und bewerten. Dies bildet die Grundlage für alle weiteren Schutzmaßnahmen.
- Technische Schutzmaßnahmen:
- Lüftungssysteme: Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung, um die Konzentration von Krankheitserregern in der Luft zu reduzieren.
- Abschirmungen: Verwendung von physischen Barrieren, wie Plexiglaswänden, um direkten Kontakt zu minimieren.
- Organisatorische Schutzmaßnahmen:
- Arbeitsplatzgestaltung: Anordnung der Arbeitsplätze mit ausreichendem Abstand zwischen den Beschäftigten.
- Arbeitszeitgestaltung: Einführung von Schichtarbeit oder versetzten Arbeitszeiten, um die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Personen zu reduzieren.
- Reinigungs- und Desinfektionspläne: Regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Arbeitsbereichen.
- Persönliche Schutzmaßnahmen:
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Tragen von geeigneter PSA wie Handschuhen, Atemschutzmasken und Schutzkleidung, abhängig von der Art der Tätigkeit und dem Expositionsrisiko.
- Hygienemaßnahmen: Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife, Nutzung von Desinfektionsmitteln und Vermeidung von Berührungen im Gesichtsbereich.
- Unterweisung und Schulung: Regelmäßige Schulungen der Beschäftigten über die Gefahren biologischer Arbeitsstoffe, richtige Hygienemaßnahmen und den korrekten Einsatz von PSA.
- Notfallmaßnahmen: Erstellung von Notfallplänen für den Fall von Infektionen oder Ausbrüchen, einschließlich Meldeketten und Quarantänemaßnahmen.
Wichtigkeit des Arbeitsschutzes im Umgang mit biologischen Gefahrstoffen
Der Arbeitsschutz spielt eine zentrale Rolle beim Umgang mit biologischen Gefahrstoffen. Durch die Implementierung geeigneter Schutzmaßnahmen können Infektionsrisiken minimiert und die Gesundheit der Beschäftigten geschützt werden. Dies ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung für Arbeitgeber, sondern trägt auch zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufs und zur Vermeidung von Ausfallzeiten bei.
Insbesondere die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung eines proaktiven und umfassenden Arbeitsschutzes verdeutlicht. Unternehmen sind gefordert, ihre Schutzkonzepte regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, um auf neue biologische Gefährdungen adäquat reagieren zu können. Weitere Hilfe dazu finden Sie hier.
Abschließend ist festzuhalten, dass der Schutz vor biologischen Gefahrstoffen eine gemeinsame Verantwortung von Arbeitgebern und Beschäftigten darstellt. Nur durch konsequente Umsetzung und Einhaltung der Schutzmaßnahmen kann ein sicheres Arbeitsumfeld gewährleistet werden.